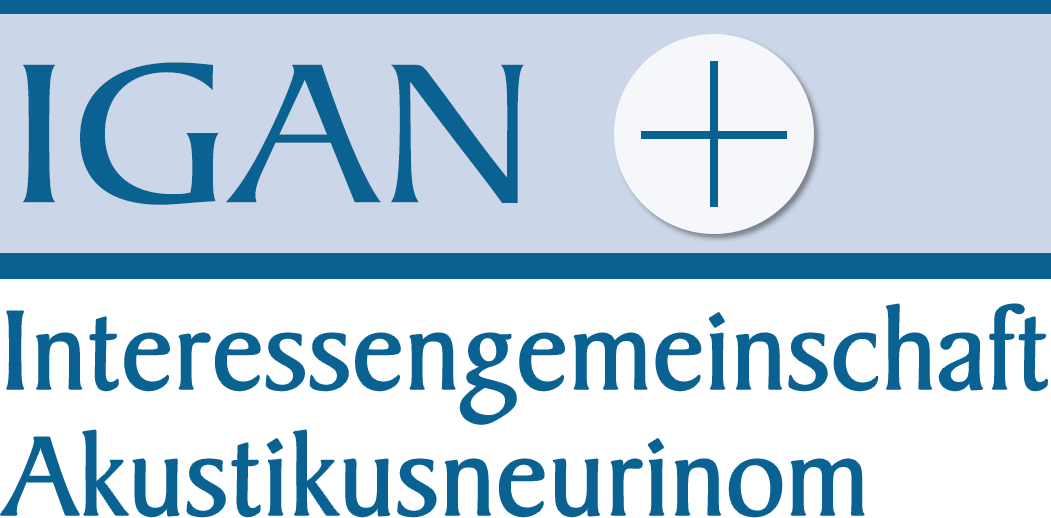Diagnose des Akustikusneurinoms: MRT
Während Hörtests und Gleichgewichtsprüfungen funktionelle Störungen nachweisen und dadurch Rückschlüsse auf die mögliche Existenz eines Akustikusneurinoms zulassen, zeigt die Magnetresonanztomographie (MRT) die anatomischen Verhältnisse in einem ausgewählten Körperbereich. Es ist das einzige Verfahren, mit dem sich ein Akustikusneurinom eindeutig diagnostizieren lässt.
Die Magnetresonanztomographie (MRT), früher auch als Kernspintomographie bezeichnet, hat als Schnittbildverfahren eine herausragende Bedeutung bei der Tumordiagnose. Besonders wertvoll ist die Möglichkeit, sehr kontrastreiche und überlagerungsfreie Bilder von Weichteilen zu erstellen. Die Besonderheit gegenüber anderen bildgebenden Verfahren, wie dem Computertomographen (CT), besteht darin, dass das MRT im Weichteilgewebe eine weitaus höhere Auflösung und Detailgenauigkeit aufweist. Damit liefert es die besten Daten für die Diagnose und unverzichtbare Informationen für die späteren Therapien – sowohl für die Planung einer Bestrahlung als auch für die Operation.
Unschädliches Verfahren
Ein weiterer Vorteil der MRT ist, dass keine schädliche Röntgenstrahlung, sondern für den menschlichen Körper unschädliche Magnetfelder eingesetzt werden. Dabei macht man sich zunutze, dass sich die Wasserstoff-Atomkerne im Körper wie kleine Magnete verhalten. Bei der Untersuchung wird ein äusserst starkes Magnetfeld angelegt. Dadurch richten sich die Kerne der Wasserstoffatome wie Kompassnadeln in Reih und Glied aus. Mittels Radiowellen kann dann die Ausrichtung der Kerne kurz geändert werden, wodurch Signale entstehen, die sich je nach Wassergehalt des Gewebes unterscheiden. Diese Signale können durch das MRT-Gerät registriert und dann durch einen Computer in Bilder umgewandelt werden.
Die entstehenden Bilder haben eine hervorragende räumliche Auflösung, sind kontrastreich und bilden selbst kleinste Veränderungen in den Weichteilen ab. Die axiale Schnittebene ist die Wichtigste. Dabei schaut man sozusagen «von den Füssen» auf den Schnitt, welcher den Körper in eine obere und untere Hälfte trennt (Transversal/Horizontalebene). Frontale Schnittaufnahmen werden «von vorne» erstellt. Durch Kontrastmittel (Gadolinium) können die Veränderungen in den Weichteilen noch stärker betont werden.


Mittels MRT ist ein Akustikusneurinom von nur wenigen Millimeter mittlerem Durchschnitt erkennbar und darstellbar. Mit der sogenannten CISS-Sequenz kann man sogar die einzelnen Hirnnerven im Gehörgang und Kleinhirnbrückenwinkel darstellen. So lässt sich eine mögliche Ausdehnung des Akustikusneurinoms deutlich erkennen.
Wie läuft eine MRT-Untersuchung ab?
Bei der Aufnahme liegt die Patientin oder der Patient auf einer Liege, die in eine «Röhre» von etwa einem Meter Länge geschoben wird. Durch das Zusammenbrechen des Magnetfeldes, kommt es in Abständen zu einem relativ lauten Pochen. Um diesen eher unangenehmen Geräuschen zu begegnen, können Patientinnen und Patienten Ohrstöpsel tragen oder Musik hören.
In manchen Fällen kommen auch sogenannte offene Kernspintomographen zum Einsatz. Dabei liegt man frei und nicht in einem engen Tunnel. Diese Geräte sind insbesondere für Patientinnen und Patienten geeignet, die unter Raumangst (Klaustrophobie) leiden.
Keine echte Akustikusneurinom-Diagnose: CT
Neben dem MRT gibt es weitere bildgebende Verfahren, wie die Computertomographie (CT). Diese kann zeigen, ob der knöcherne Gehörgang aufgeweitet ist, was auf die Existenz eines Akustikusneurinoms schliessen lässt. Eine eindeutige Diagnose ist mit der CT allerdings nicht möglich. Die grössere Bedeutung hat sie für die Operationsplanung, weil sie die knöchernen Strukturen (die hintere Schädelgrube und den knöchernen Gehörgang) sehr gut abbildet.